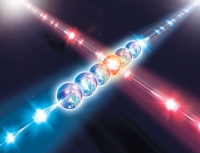
[2011-09-02] Dem Wunsch, auch sehr komplexe Phänomene an einem Modell untersuchen zu können, sind Physiker der Universität Innsbruck und des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) in Innsbruck ein wesentliches Stück näher gerückt. Sie haben im Labor einen digitalen, und damit universellen Quantensimulator realisiert. Mit ihm kann im Prinzip jedes beliebige physikalische System effizient simuliert werden. Die Fachzeitschrift Science berichtet darüber in ihrer Online-Ausgabe Science Express.
Vor knapp zwei Jahren bildeten Forscher um Rainer Blatt und Christian Roos von der Universität Innsbruck die Eigenschaften eines sich nahe an der Lichtgeschwindigkeit bewegenden Teilchens in einem Quantensystem nach. Dazu haben sie die Eigenschaften des Teilchens mit Hilfe von Lasern in ein stark gekühltes Kalziumatom eingeschrieben und dieses mittels Messungen untersucht. So konnten sie die sogenannte Zitterbewegung von relativistischen Teilchens simulieren, die in der Natur nie direkt beobachtet wurde. Nun haben die Innsbrucker Physiker anstelle dieses analogen Ansatzes einen digitalen verwendet. Mit einem digitalen, universellen Quantensimulator lässt sich potentiell jedes beliebiges physikalische System effizient simulieren. „Wir haben in unserem Experiment gezeigt, dass die Methode funktioniert und dass wir damit andere Systeme virtuell nachbilden und untersuchen können“, erklärt Benjamin Lanyon vom Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. „Wollen wir ein anderes Phänomen studieren, müssen wir unseren Simulator lediglich umprogrammieren.“
Quantencomputer at its best
Zur Simulation nutzen die Innsbrucker Physiker die Bausteine eines Quantencomputers. Die mathematische Beschreibung des zu untersuchenden Phänomens wird dazu in Form von Rechenschritten in den Quantencomputer programmiert. Im Experiment dienen in einer Vakuumkammer gefangene und mit Lasern stark abgekühlte Kalziumatome als Träger von Quantenbits. „Wir schreiben die gewünschten Anfangszustände des zu untersuchenden Systems in die Quantenbits ein und führen mit Hilfe von Laserpulsen die einzelnen Rechenschritte durch“, erklärt Christian Roos. In zwei Experimenten an der Universität Innsbruck und am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) haben Roos und seine Kollegen dies an bis zu sechs Quantenbits mit bis zu 100 Rechenoperationen durchgespielt. „Das Neue daran: Es werden Interaktionen und Dynamiken simuliert, die im Quantencomputer selbst gar nicht vorhanden sind“, zeigt sich Benjamin Lanyon begeistert. Er ist überzeugt davon, dass dies eine der aussichtsreichsten Anwendungen eines zukünftigen Quantencomputer sein wird. „Dafür benötigen wir allerdings noch wesentlich mehr Quantenbits. Das heißt, wir müssen deutlich mehr Ionen - bis zu 40 - so exakt kontrollieren und ansteuern wie in unserem Experiment“, sagt Lanyon.
Theoretischer Ansatz erstmals bestätigt
Physikalische Phänomene werden oftmals durch Gleichungen beschrieben, die zu kompliziert sind, um sie exakt lösen zu können. Daher stützt sich die Wissenschaft oft auf Computersimulationen, um offene Fragen am Modell untersuchen zu können. Da diese Strategie selbst für relativ kleine Quantensysteme an der mangelnden Rechenleistung herkömmlicher Computer scheitert, hat der amerikanische Physiker Richard Feynman vorgeschlagen, diese Phänomene in Quantensystemen selbst experimentell zu simulieren. 1996 bestätigte der Theoretiker Seth Lloyd diesen Ansatz: Quantencomputer können so programmiert werden, dass sie jedes beliebiges physikalische System effizient simulieren. Voraussetzung dafür sind freilich eine extrem gute Beherrschung der Technologie des Simulators. All dies hat die erfolgreiche Forschungsgruppe um Rainer Blatt mit ihren Experimenten zu Quantencomputern in den vergangenen Jahren in Innsbruck aufgebaut. So konnten die Physiker jetzt erstmals einen digitalen, universellen Quantensimulator experimentell erproben.
Die nun in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Forschungsarbeit wurde unter anderem vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, der Europäischen Kommission und der Tiroler Industrie unterstützt.