
Der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen kürte die Innsbrucker Quantenphysikerin Francesca Ferlaino zur Wissenschaftlerin des Jahres. Die gebürtige Italienerin forscht seit 2006 am Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck und ist seit 2014 wissenschaftliche Direktorin am Innsbrucker Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), in der sie auch Mitglied ist.
Weiterlesen … Francesca Ferlaino ist Wissenschaftlerin des Jahres

Der Nationale Forschungsrat in Spanien (CSIC) – eine zentrale Einrichtung des Wissenschaftsministeriums – hat Peter Zoller eine Gastprofessur – einen sogenannten JAE-Chair – zugesprochen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird der Theoretische Physiker gemeinsam mit Kollegen am CSIC-Instituto De Física Fundamental an einem Projekt zu Quantentechnologien arbeiten.
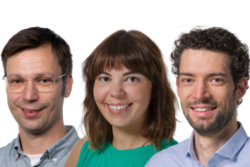
Der Österreichische Wissenschaftsfonds FWF hat einen neuen Spezialforschungsbereich zu Quantensystemen von neutralen Atomen bewilligt. Vom IQOQI Innsbruck sind die Forschungsgruppen um Hannes Bernien, Francesca Ferlaino und Hannes Pichler daran beteiligt. Der FWF fördert das neue Forschungsnetzwerk über vier Jahre hinweg mit rund 4 Millionen Euro.
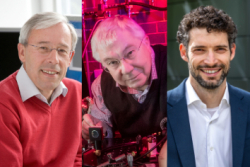
Alljährlich veröffentlicht der Datenkonzern Clarivate eine Liste mit den meistzitierten – und damit einflussreichsten – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. In der aktuellen, am Mittwoch veröffentlichten Aufstellung finden sich 6.868 „Highly Cited Researchers“ aus 60 Ländern – 3 davon vom IQOQI Innsbruck: Rainer Blatt, Hannes Pichler und Peter Zoller.